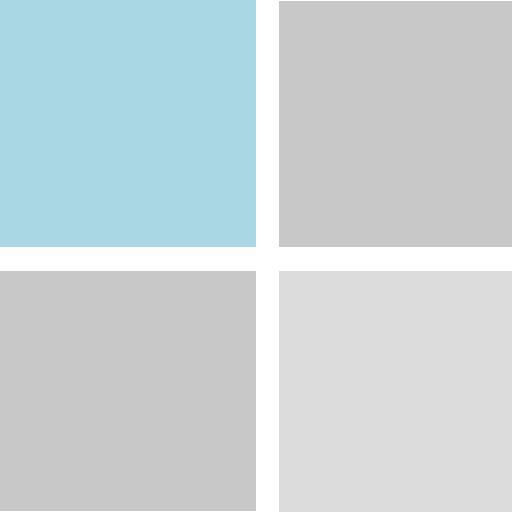Ich stehe hier, und es ist, als würde die Welt kurz den Atem anhalten. Die Luft ist schon kühl, so eine feuchte, schwere Kühle, die nach See und ein bisschen nach altem Stein riecht. Ich atme tief ein, und das ist mein Moment, ganz allein.
Vor mir liegt das Wasser, tief und dunkel, fast wie flüssiges Metall. Es bewegt sich kaum, nur so ein leises, ewiges Wogen, das klingt wie ein Flüstern, das nie ganz verstummt. Ich höre sonst nichts, außer vielleicht das ferne Kichern von drüben, wo die Lichter brennen. Das ist der Ort, wo die anderen sind, wo das Leben laut ist.
Meine Augen kleben an den Bergen. Die sind so riesig, so schwarz gegen den letzten Rest Licht am Himmel. Da oben, ganz mittig, hängt der Mond. Er ist nicht voll, nur so ein blasser, ungeduldiger Fleck, der sich im Wasser spiegelt, aber die Spiegelung ist zerrissen, wie ein alter Brief.
Ich mag diese Melancholie. Dieses Gefühl, dass alles stillsteht, aber trotzdem alles fließt. Die Lichter am Ufer, dieses warme, gelbe Leuchten, das ist so ein schöner Kontrast zu dem tiefen Blau und Schwarz. Es sieht aus wie eine kleine, heimliche Party, zu der ich nicht eingeladen bin, aber das ist okay. Ich bin lieber hier, in der Stille.
Meine Hände sind kalt, aber das stört mich nicht. Ich fühle die Textur der Luft, wenn man das so sagen kann. Es ist nicht nur kalt, es ist dicht. Ich bin eine Beobachterin, das war ich schon immer. Und hier, in diesem Halbdunkel, sehe ich die Schönheit im Detail: die winzigen Wellen, die das Licht brechen, die Silhouette des alten Hauses dort rechts, das aussieht, als würde es eine Geschichte erzählen, die keiner mehr hören will.
Manchmal denke ich, das ist das wahre Leben. Nicht das Laute, nicht das Helle. Sondern dieses Zwischenspiel von Licht und Schatten, von Nähe und Ferne. Es ist ein bisschen traurig, ja, aber auch wunderschön. Und ich stehe hier und weiß: Das hier, das ist meins. Das nehme ich mit.