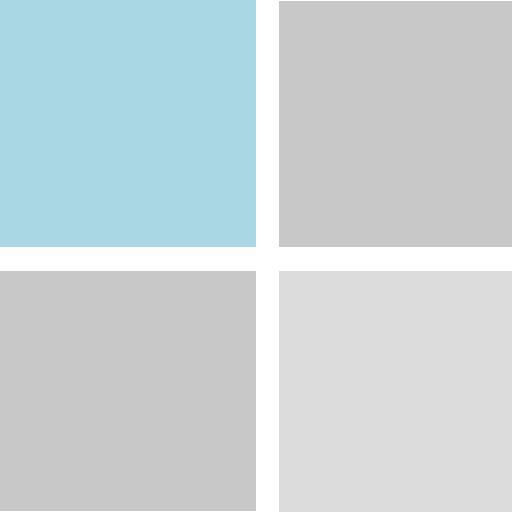Ich stehe hier, mitten auf dem Campo, und spüre, wie die Kälte des Regens langsam durch meinen Mantel zieht. Es ist kein harter Guss mehr, nur noch ein feines, stetiges Rauschen, das die Stille nicht bricht, sondern nur untermalt. Die Luft riecht nach altem Stein und Salz, eine Mischung, die nur diese Stadt kennt.
Ich blicke nach oben. Der Mond ist heute Nacht unverschämt hell, eine bleiche Scheibe, die sich mühsam durch die zerrissenen, grauschwarzen Wolken kämpft. Er wirft ein kaltes, fast unwirkliches Licht auf die Fassaden der alten Palazzi, die links und rechts von mir in den Himmel ragen. Ihre Ziegel sind nass, die Textur der Jahrhunderte tritt durch die Feuchtigkeit noch deutlicher hervor.
Aber das wahre Licht kommt von unten. Das Pflaster unter meinen Füßen, diese unregelmäßigen, dunklen Steine, saugt das Wasser auf und wird zu einem Spiegel. Die Fenster der Häuser sind kleine, warme Quadrate, gefüllt mit einem tiefen, honiggelben Licht. Dieses Licht fällt auf den nassen Boden und zerfließt dort zu langen, zitternden Streifen aus purem Gold. Es ist, als hätte jemand die ganze Einsamkeit der Nacht genommen und sie mit einem einzigen, warmen Versprechen bemalt.
Ich bin die einzige hier. Kein Schritt, kein Gespräch, nur das leise Zischen des Regens, wenn er auf die Steine trifft. Es ist dieser Moment, in dem die Welt anhält, in dem ich nur Beobachterin bin. Ich sehe das Detail: wie ein Tropfen an der Kante eines Fensterbretts hängt, bevor er fällt. Wie die Schatten der Gassen in tiefes, undurchdringliches Violett kippen.
Es ist eine melancholische Schönheit, ja. Aber es ist keine Traurigkeit. Es ist die Ruhe, die kommt, wenn man weiß, dass man in diesem riesigen, nassen, mondbeschienenen Theater für einen Augenblick die Hauptrolle spielt – oder besser gesagt, die einzige Zuschauerin ist. Ich atme tief ein. Der kalte, salzige Geruch füllt meine Lungen. Ich fühle mich klein und doch unendlich verbunden mit diesem Ort, mit dem Gold, das auf dem nassen Stein tanzt. Und das ist alles, was zählt.