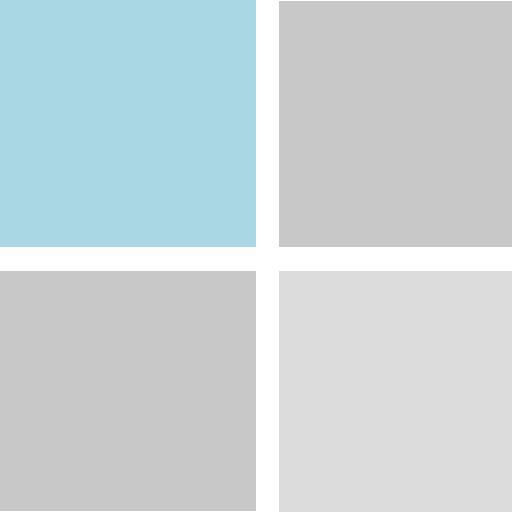Ich stehe am Rand des Wassers, wo die Steine unter meinen Füßen kalt und feucht sind, als hätten sie den Atem des Meeres in sich gesogen. Die Luft ist kühl, aber nicht unangenehm – sie streicht über meine Haut wie ein zögernder Finger, der sich nicht entscheiden kann, ob er bleiben oder weiterziehen soll. Irgendwo zwischen dem Dunkelblau des Himmels und dem flüssigen Gold der Laternen hängt die Zeit.
Die Laternen. Sie sind es, die diesen Moment zu etwas Heiligem machen. Ihr Licht ist nicht grell, nicht aufdringlich, sondern sanft und schwer, als würde es aus einer anderen Zeit sickern. Es tropft auf das Wasser, auf die alten Steine, auf die Umrisse der Gondel, die sich langsam, fast träge, durch den Kanal schiebt. Der Gondoliere steht aufrecht, sein Schatten lang und schmal, als wäre er nicht aus Fleisch, sondern aus demselben Stoff wie die Dämmerung. Seine Bewegungen sind flüssig, aber ich höre kein Geräusch – nur das leise, fast unmerkliche Plätschern des Wassers gegen das Holz.
Hinter mir ragt die Basilika auf, ihre Kuppeln wie stumme Wächter. Ihr Stein ist nicht mehr weiß, nicht mehr rein, sondern getränkt von Jahrhunderten, von Regen, von Salz, von den Händen unzähliger Menschen, die hier vorbeigegangen sind. Die Fassade reflektiert das letzte Licht des Tages, aber es ist kein strahlendes Glänzen, sondern ein mattes, gedämpftes Schimmern, als würde das Gebäude selbst atmen.
Ich atme ein. Die Luft schmeckt nach Stein und nach Wasser, nach dem leisen Metallgeruch der Laternen, nach etwas, das ich nicht benennen kann – vielleicht nach der Erinnerung an alle Abende, die hier schon vergangen sind. Irgendwo in der Ferne, so leise, dass ich es fast nicht höre, das Klirren eines Glases, das Knarren eines Holzstegs. Aber es ist nicht störend. Es gehört dazu, wie das leise Rascheln der Blätter, die sich irgendwo an den Kanalufern an die Mauern schmiegen.
Ein Windstoß. Er ist kaum der Rede wert, aber er trägt den Duft von nassem Holz mit sich, von Moos, das sich zwischen den Steinen festkrallt. Ich spüre, wie er meine Haare bewegt, wie er die Oberfläche des Wassers kräuselt, als würde er mit unsichtbaren Fingern darüberstreichen. Die Gondel gleitet weiter, der Gondoliere beugt sich leicht vor, sein Ruder taucht ein, zieht eine Spur durch das Wasser, die sich sofort wieder schließt, als wäre nichts gewesen.
Die Laternen werfen ihr Licht auf die Wellen, und für einen Augenblick glaubt man, das Wasser brenne. Es ist kein Feuer, kein grelles Licht, sondern etwas Wärmeres, Weicheres – wie flüssiger Honig, der sich langsam ausbreitet. Ich beuge mich vor, strecke die Hand aus, als könnte ich ihn berühren. Aber er ist schon wieder weg, aufgelöst in der Dunkelheit, die langsam alles umarmt.
Die Basilika wirkt jetzt noch größer, noch stiller. Ihre Fenster sind dunkel, als würde sie schlafen. Aber sie schläft nicht. Sie wartet. Wie ich. Wie das Wasser. Wie die Steine. Wir warten alle auf etwas, das nicht kommt, das vielleicht nie kommen wird – und das ist in Ordnung.
Ich schließe die Augen. Hinter meinen Lidern tanzen die Lichter der Laternen, orange und golden. Ich höre mein eigenes Atmen, das sich mit dem leisen, gleichmäßigen Klatschen des Wassers vermischt. Irgendwo ruft eine Möwe, ein einsamer, schriller Schrei, der sich in der Weite verliert. Dann ist es wieder still.
Als ich die Augen öffne, ist die Gondel weitergezogen. Der Gondoliere ist nur noch ein Schatten, fast verschwunden in der Dunkelheit. Die Laternen brennen immer noch. Ihr Licht fällt auf meine Hände, und für einen Moment glaube ich, es wäre mein eigenes Blut, das dort golden schimmert.
Ich bleibe stehen. Die Nacht wird tiefer, der Himmel dunkler, aber die Laternen halten stand. Sie brennen weiter, gleichmäßig, geduldig. Wie ein Versprechen.