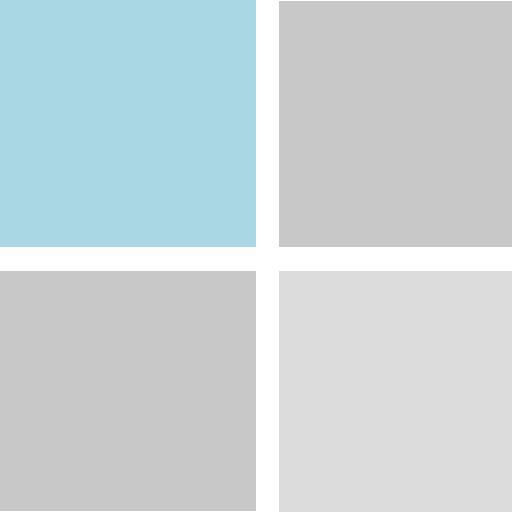Lukas, mein deutscher Ingenieur, reist für ein Projekt nach Boston. Clémence, die französische Wissenschaftlerin, arbeitet dort seit zwei Jahren und ist längst zerrissen zwischen ihrem alten Leben in Paris und der Unsicherheit in Amerika. Eigentlich sollten sie sich nur zu Geschäftszwecken begegnen. Doch wie das so ist: Manchmal genügt ein einziges Lächeln, ein einziges ehrliches Wort, um eine neue Realität zu erschaffen.
Mich reizte an dieser Konstellation nicht nur das klassische „Frau trifft Mann“ – sondern der kulturelle und emotionale Ballast, den beide mitbringen. Lukas schleppt seine gescheiterte Ehe mit nach Boston, die ihn nüchterner, vielleicht auch vorsichtiger gemacht hat. Clémence lebt mit der ständigen Angst, ihr Visum könnte nicht verlängert werden – sie weiß, dass ihr Zuhause auf wackeligen Füßen steht. Zwei Menschen, die beide „fremd“ sind, selbst dort, wo sie gerade leben.
Gerade diese Fremdheit verbindet sie. Und gleichzeitig ist sie die größte Herausforderung. Wie geht man eine Beziehung ein, wenn man nicht weiß, in welchem Land man in einem Jahr lebt? Wie viel Mut erfordert es, Gefühle zuzulassen, während der Boden unter einem schwankt?
Boston ist in diesem Roman nicht nur Kulisse, sondern Bühne. Die alte Hafenstadt wirkt gleichzeitig europäisch und amerikanisch, vertraut und fremd – genau wie die Gefühle meiner Protagonisten. In den schmalen Straßen von North End, in den Jazzbars von Roxbury, am Hafen mit Blick auf das Meer – überall spiegelt die Stadt die inneren Spannungen wider. Lukas erlebt Boston zunächst als anonymen Geschäftsreise-Ort, doch durch Clémence entdeckt er das echte Boston: die versteckten Plätze, die Geschichten, die Wärme.
Und dann ist da das Thema „Wahrheit“. Lukas verkauft Maschinen, aber eigentlich verkauft er – wie Clémence es bemerkt – die Wahrheit. Seine Direktheit irritiert Amerikaner, aber genau diese Ehrlichkeit macht ihn für sie so besonders. Clémence wiederum kämpft mit der Frage, ob sie ihr Leben weiter auf „vielleicht“ bauen soll – vielleicht bleibt sie, vielleicht wird sie ausgewiesen, vielleicht wird Phoenix, ihr Forschungsprojekt, ein Erfolg. Ihre Begegnung mit Lukas zwingt sie, Antworten zu finden, die über die Wissenschaft hinausgehen.
Für mich ist „Transatlantische Gleichung“ ein Roman über den Mut zur Unsicherheit. Über zwei Menschen, die wissen, dass ihre Liebe alles andere als praktisch ist – und sie trotzdem riskieren. Es ist ein Roman über Entscheidungen, die man nicht verschieben kann, weil das Leben sonst für einen entscheidet.
Und vielleicht ist es genau das, was mich an solchen Geschichten so fasziniert: die Frage, wie weit wir bereit sind, für ein Gefühl zu gehen. Über Kontinente hinweg, über die eigene Angst, über die Bequemlichkeit der Routine.
Ich glaube, manchmal müssen wir unsere ganz persönliche Gleichung lösen: zwischen Herz und Kopf, zwischen Risiko und Sicherheit, zwischen Vergangenheit und Zukunft. Lukas und Clémence versuchen es. Und vielleicht erkennen wir in ihrer Geschichte ein Stück unserer eigenen.
LESEPROBE
Kapitel 1 – Stop Loss
Frankfurt, 7:42 Uhr. Draußen klirrt der Novemberregen gegen die Scheiben wie eine kaputte Klimaanlage auf Koks. Ich starre auf sechs Bildschirme, sehe nichts. Zahlen tanzen, Balken blinken. Mein Kopf rauscht.
Tommi kaut laut. Müsli mit Chiasamen. Immer diese Scheiß-Chiasamen. Als würden sie ihm den Arsch retten, wenn der DAX wieder abrauscht.
Ich trinke den dritten Espresso. Der schmeckt wie durch ein altes T-Shirt gefiltert. Vielleicht ist es auch das T-Shirt. Hab seit zwei Tagen nicht mehr gewechselt. Lea sagt gestern, ich seh aus wie ein schlechter Screenshot meiner selbst. Ich lache nicht. Sie meint’s nicht böse. Lea meint nie was böse.
Stop Loss. Ich höre das Wort wie durch Watte. Gregors Stimme, glitschig wie ein Aal im Anzug: „Jannis, was machst du da gerade? Die Techs brechen weg.“
Ich mache nichts. Ich beobachte. Ich warte. Dann drücke ich. Einen Knopf. Falscher Knopf. Oder richtiger, das weiß man immer erst später.
Ein Alarmton pfeift schrill. Ich glaub, es ist mein Hirn. Die Bildschirme explodieren nicht, aber sie könnten.
Gregor ist plötzlich hinter mir. Seine Hände klatschen auf die Lehne meines Stuhls wie Haftbefehle. „Willst du mir erklären, was das war?“
Ich drehe mich langsam um. Schaue ihn an. Seine Krawatte hat so ein Fischgrätmuster, als würde sie rückwärts schwimmen. Ich sage: „Nein.“
Er sagt: „Du hast gerade siebenstellig versenkt.“
Ich sage: „Ich hab mich vertan.“ Er starrt. „Das war keine Versehenstaste, Jannis.“ Ich sage: „Ich glaub, ich bin müde.“ Er sagt nichts. Atmet durch die Nase. Wie ein Yoga-Stier.
Ich stehe auf. Meine Knie sind Gummi. Gehe durch den Raum, vorbei an Leuten, die plötzlich so tun, als wären sie in Excel vertieft. Ich öffne das Fenster in der Teeküche. Kalte Luft schlägt mir ins Gesicht. Für einen Moment denke ich: Jetzt springen. Aber ich bin im dritten Stock. Das bringt höchstens eine Verstauchung.
Lea kommt rein. Hält mir eine Tasse hin. „Tee. Beruhigt.“ Ich nehme sie. Sage: „Danke. Ich kündige morgen.“ Sie lacht. Dachte, ich mach Witze. Ich nicht.
In der Nacht schlafe ich nicht. Ich laufe durch meine Wohnung wie ein Tier im Käfig. Bücherregale, die nur Deko sind. Klamotten, die nach zu viel Leben riechen. Ich tippe „Australien Abenteuerurlaub“ in die Suche. Klick. Klick. Noch ein Klick. Plötzlich hab ich ein Ticket. One-Way. Darwin. Abflug in 11 Tagen.
Ich leg mich auf den Boden. Spüre das Parkett unter dem Rücken. Und plötzlich – für drei Minuten – ist alles ruhig. Dann klingelt das Handy. Gregor. Ich geh nicht ran. Ich geh nie wieder ran.